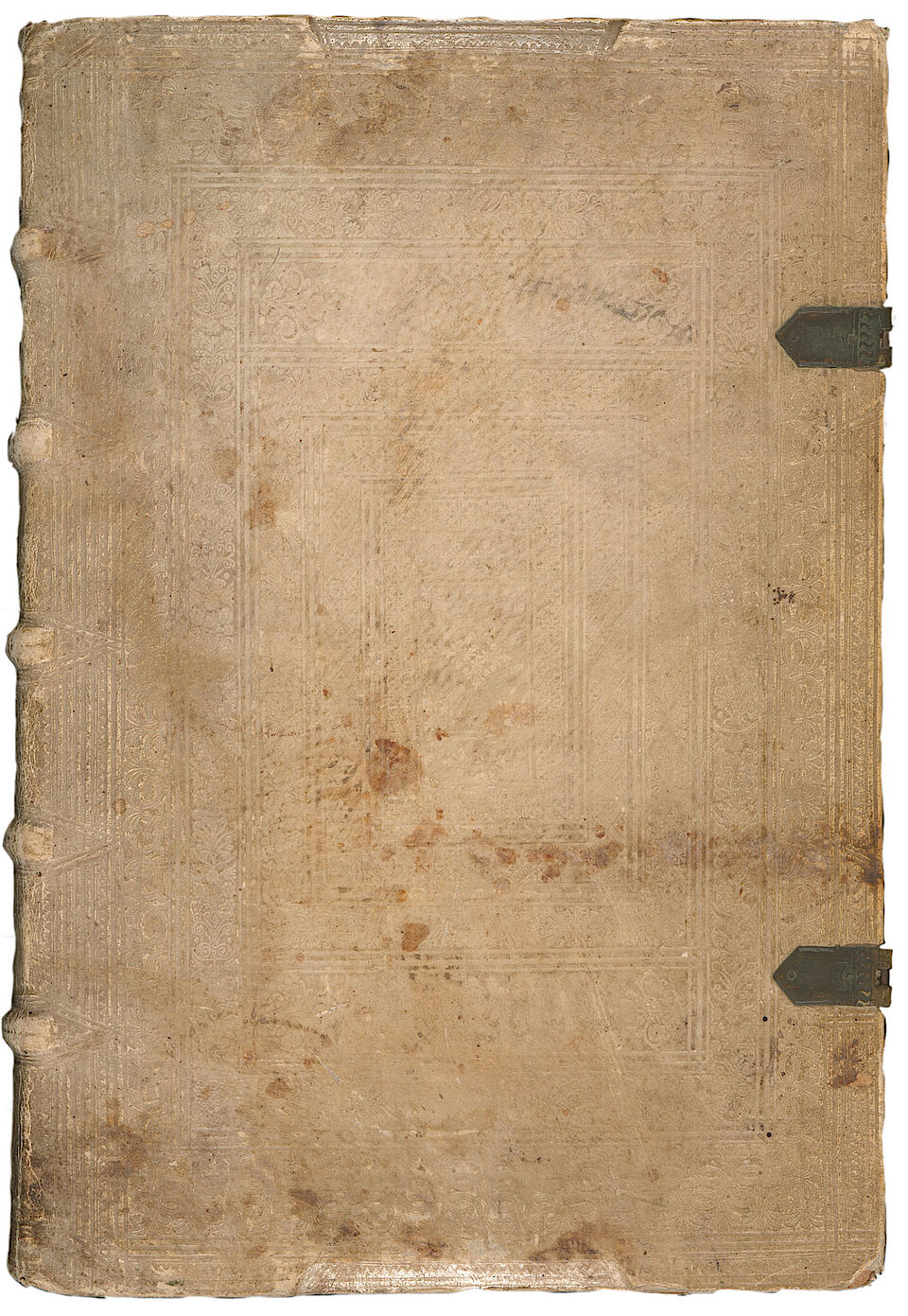Eine grosse (nicht nur lange) Geschichte
Georg Christoph Lichtenberg hat das allgemeine Problem einmal treffend umschrieben: "Wenn man die Natur als Lehrerin, und die Menschen als Zuhörer betrachtet, so ist man geneigt, einer ganz sonderbaren Idee vom menschlichen Geschlechte Raum zu geben. Wir sitzen allesamt in einem Collegio, haben die Prinzipien, die nötig sind, es zu verstehen und zu fassen, horchen aber immer mehr auf die Plaudereien unserer Mitschüler, als auf den Vortrag der Lehrerin." Ein gutes Beispiel hierfür gibt die Promotionsordnung der Medizinischen Fakultät Basel im späten 15. Jahrhundert. Sie schreibt vor, dass nur zum Doktor der Medizin werden kann, wer "während eines Monats täglich eine Stunde Vorlesung [hält] und in denselben die Aphorismen des Hippokrates oder Galeni ars medica [interpretiert], und zwar griechisch." (Friedrich Miescher-His, Die medizinische Facultät in Basel..., S., 8). Statt den menschlichen Körper zu betrachten, wurden also Bücher gelesen, wieder und wieder, möglichst im Original. Der Arzt Theophrastus von Hohenheim, genannt Paracelsus, der für ein knappes Jahr in Basel lehrte, war gehörte zu den ersten, nicht länger bereit waren, diesen "Plaudereien unserer Mitschüler" weiter zuzuhören; er konzentrierte sich stattdessen – auf die Lehrerin selbst.
Damit zog Paracelsus sich den Unmut seiner "Mitschüler" auf sich und wurde daher schlecht genug aufgenommen, um Basel schnell wieder zu verlasssen. Er war wesentlich durch die Bemühungen eines der führenden europäischen Buchdrucker, Johannes Frobenius, nach Basel geholt worden. Basels führende Rolle im Buchdruck – und damit als Verkehrsknotenpunkt des Wissens – brachte auch eine zweite wichtige Persönlichkeit der Geschichte der europäischen Medizin nach Basel: Andreas Vesalius, auch er ein Vertreter der Ansicht, dass die eigene Anschauung für ein gutes Urteil unverzichtbar sei. In den Jahren zuvor hatte er zahlreiche eigene Sektionen durchgeführt und kannte das Innere des menschlichen Körpers besser als die meisten anderen europäischen Mediziner. Er hatte von einem Schüler Tizians das Zeichnen gelernt und arbeitete mit Stechern zusammen, um seine Beobachtungen so genau wie möglich festzuhalten. Aus eben diesem Grund kam er nach Basel, weil er dort die besten Fachleute im Buchdruck fand, die imstande waren, die Abbildungsgenauigkeit auch bei hohen Auflagen zu gewäherleisten. So sind die in seinem "De humani corporis fabrica" enthaltenen Darstellungen so genau, dass sie das Medium der anatomischen Atlanten begründeten und über Jahrhunderte hinweg den Standard anatomischer Darstellungen definierten.
Zu den von Vesalius inspirierten Medizinern kann der Basler Felix Platter gezählt werden. Als er ab 1559 in Basel öffentliche Sektionen durchführte, wurde die eigene Anschauung nicht mehr kategorisch abgelehnt, wie dies noch bei Paracelsus der Fall war. Felix Platter hatte durch eigene Untersuchungen unter anderem in den Bereichen Anatomie, Psychologie, Pharmazie und Epidemiologie unmittelbaren Anteil daran, dass sich die Medizin immer mehr zu einer empirischen Wissenschaft entwickelte, die in einer gemeinschaftlichen, über Jahrhunderte hinweg betriebenen, Arbeit Beobachtungen amalgamiert und bessere Therapien entwickelt. Über Platters programmatisch Observationes betitelte Sammlung von fast 700 Krankengeschichten schreibt etwa Robert Leventhal: "his Observationes stand out for their explicit empirical methodology." (1) Nicht die tausendste Relektüre Galens, sondern die eigenen Augen, Hände und Ohren wurden hier zu den Medien der Erkenntnis. Koelbing schreibt, Platter habe "die unvermeidlicherweise noch galenische Medizin mit vesalischem Geist imprägniert." (2)
Platters Kollege Theodor Zwinger der Ältere verlangte völlige Freiheit für die Naturforschung und trug so dazu bei, dass "das auf Aristoteles und Galen fundierte Gebäude der Philosophie und Naturwissenschaften endgültig zu bröckeln begann" (3). In einer Zeit der Bücherzensur und anonymen und heimlichen Druckern in Basel "beeindruckt der zähe und unbeirrbare Wille dieser Männer, die Freiheit der religiösen Entscheidung und die freie wissenschaftliche Forschung zu erkämpfen." (4) Die Entflechtung der eigenen Anschauung aus den philosophisch-religiösen Traditionen wird noch Jahrhunderte andauern, und Zwingers Begriff von freier Forschung ist von dem heutigen noch weit entfernt. Umso mehr ist sein Ringen um diese neue Form des Wissenserwerbs bemerkenswert. In einem seiner Kommentare zu Hippokrates de Elegantia unterscheidet Zwinger drei Instrumente: erstens ein angeborenes Talent, Dinge zu erfinden, zweitens erlernte Kenntnisse, und drittens "die Erfahrung der Dinge mit unseren Händen […]. Wer diese letztere hat […] der wird immer richtig erkennen und urteilen; wer sie nicht hat, der kann wohl einmal richtig, aber dann aich wieder falsch tun." (5)
Obwohl Paracelsus vom Hof gejagt wurde und Vesalius nur kurz in Basel weilte, kam die Medizinische Fakultät doch durch sie, Platter, Zwinger und andere in hinreichend engen Kontakt zu einer damals neuen Schule des Denkens, die bis heute prägend geblieben ist. Das von Paracelsus als "experimenta ac ratio" bezeichnete Prinzip der Verschränkung von eigener Anschauung und rationalem Denken prägt bis heute unser Selbstbild. Heute sprechen wir von "praxisbasierter Forschung", von "Translation", von einer Lehre auf dem neuesten Stand der Forschung – und aktualisieren damit eine seit Jahrhunderten zukunftsweisende Idee. Mit Lichtenberg gesagt haben wir gelernt, der Lehrerin zuzuhören, auch wenn sie immer mal wieder übertönt wird vom Getuschel unserer Mitschülerinnen und Mitschüler.
- (1) Robert Leventhal, Making the Case. Narrative Psychological Case Histories and the Invention of Indivudality in Germany, 1750–1800, Berlin, Boston 2019, S. 23
- Huldrych M. Koelbing, Felix Platters Stellung in der Medizin seiner Zeit, in: Gesnerus. Swiss Journal of the history of medicine and sciences, (22) 1965, S. 59–67, hier S. 67
- (3) Carlos Gilly, Theorie zwischen Erfahrung und Spekulation. Theodor Zwinger und die religiöse und kulturelle Krise seiner Zeit, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, (77) 1977, S. 57–, hier S. 61
- (4) Gilly, 61f.
- (5) Gilly, 103
Literatur: Edgar Bonjour, Die Universität Basel von den Anfängen bis zur Gegenwart, 1460- 1960, Basel 1960.
Georg Kreis, Die Universität Basel 1960-1985, Basel 1986.
Webseite Universitätsgeschichte Basel 1460–2010, https://unigeschichte.unibas.ch/ (20.04.2023).